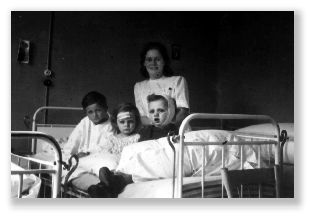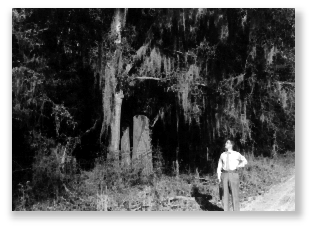Meine Erinnerungen
von Marianne Mützenberg-Ludwig, Frick
1997
als PDF-Datei downloaden [16.8 MB]
Meine Erinnerungen an meine frühe Jugend und
späteren Jahre begleiten mich durch mein Leben. Ich schreibe sie
auf, weil es mich schon immer dazu drängte.
Es sind auch so viele Veränderungen
geschehen, seit ich auf der Welt bin. Im Jahr 1927, meinem
Geburtsjahr, flog Lindbergh zum ersten Mal über den Atlantik.
Wer hätte damals gedacht, dass im Jahr 1969 der erste Mensch auf
dem Mond landen würde! Dann kamen Fernsehen, Computer, etc.
etc., und alles ist heute selbstverständlich.
Nun zu mir. Ich kam am 30. März 1927 in Bern
zur Welt, mein Onkel Fritz Ludwig, Frauenarzt und Bruder meines
Vaters, half mir dabei. Ich wuchs aber in Burgdorf an der
Heimiswilstrasse auf, zusammen mit meinem älteren Bruder Ruedi
und der jüngeren Schwester Silvia.
Bevor ich aber über mich erzähle, sollte
ich etwas über meine Eltern sagen, sie gehören ja auch zu
meinem Leben. Mein Vater wurde 1892 in Burgdorf geboren, er war das
zweitjüngste von neun Geschwistern. Seine Mutter starb bei der
Geburt des letzten Kindes. Mein Vater wuchs zusammen mit einem
gerechten, aber strengen Vater auf, Haushälterinnen und
älteren Schwestern, die ihn alle erziehen wollten, Mutterliebe
kannte er nicht. Sie wohnten auf dem Gsteig, das „Villenviertel"
von Burgdorf, sein Vater war Direktor in einer
Textilfabrik.
Meine Mutter, sie kam 1895 in Burgdorf zur Welt,
hatte drei Schwestern und zwei Brüder. Im Jahr 1918, Ende des
Ersten Weltkrieges, erkrankte die ganze Familie an der schweren
Grippe, die damals wütete. Mein Grossvater starb daran, und
meine Grossmutter blieb mit sechs Kindern allein. Sie erwarb das
Restaurant Post am Bahnhof, sie war eine tüchtige und tapfere
Frau. Die vier Töchter mussten im Restaurant mithelfen, und Mama
erzählte mir, dass sie oft auf der Treppe in den Keller, um
Getränke zu holen, sitzen blieb und weinte. Sie hatte das
Gefühl, zu Höherem geboren zu sein! Aber Grossmutter war
aufgeschlossen. Ein Sohn wurde Arzt, einer Architekt und Mama, die
sehr talentiert war, durfte am Konservatorium Klavierunterricht
nehmen.
|
Unser Haus war zweistöckig, unten
die Mechanische Werkstatt und das Büro, oben die
Wohnräume, dann der geräumige Estrich mit noch
zwei Zimmern. Ein grosser Garten war da, und das
Allerschönste für uns, ein Bächlein floss
mitten hindurch. Der Bach war aber nicht nur zu unserem
Vergnügen da, er wurde tagsüber mit dem Wehr
gestaut, um die Turbine anzutreiben, um alle die Maschinen
in der Werkstatt in Gang zu bringen. Wie schaute ich da oft
fasziniert in das Turbinenhäuschen, um dann jeweils
schnell wieder die Türe zu schliessen.
|

|
Mama hatte schöne Blumen vorne im Garten,
Dahlien, Rosenbäumchen, dann viel Gemüse. Hinter dem Haus
befand sich eine Hofstatt mit vielen Apfel- und Birnenbäumen,
dort war auch eine grosse Lagerhalle für die fertigen
Knetmaschinen für die Bäckereien, die in der Werkstatt
hergestellt wurden.
Vorne im Garten neben dem Bach stand eine hohe
Tanne. Ruedi verbrachte viele Stunden dort oben, und ich wunderte
mich, was er wohl machte. Auf meine Frage sagte er, es sei viel zu
gefährlich für mich, hinaufzugehen. Und übrigens gehe
es mich nichts an! Natürlich stach mich der „Gwunder", und
eines Tages nahm ich allen Mut zusammen, kletterte Ast um Ast hinauf.
Und was sah ich zuoberst, ein Bretterverschlag zwischen den Aesten,
und schön geschützt seine Lieblingsbücher. Aha, dort
las er, ohne von jemandem behelligt zu werden! Von dort aus hat er
wohl auch mit der Steinschleuder auf Nachbar Kränger`s
Hühner geschossen, die dann jeweils wild gackernd herumflogen.
Das hat auch nicht zu gutem nachbarlichem Einvernehmen beigetragen.
Und meine Strafe für meinen Einbruch in sein Heiligtum waren
Arme und Beine voll klebrigen Harz.
Ueber der Strasse, wo damals fast nur Fuhrwerke
von Heimiswil her verkehrten, war ein Waldstück, dort sammelten
wir Morcheln. Dann war die nahe Emme, die Flühe, wo wir
spazieren gingen und Heidelbeeren pflückten.
|
Was wären alle diese Jahre ohne Mama
gewesen. Für den Haushalt hatte sie stets eine
Lehrtochter, die sie beim Kochen anleiten musste, aber es
war auch eine Hilfe, im Garten und überall. Heisses
Wasser musste zuerst noch auf dem Gasherd gekocht werden.
Daneben gab Mama Klavierstunden, und sie nähte alles
für uns. Zweimal im Jahr kam Herr Annaheim, ein
Vertreter aus Thun, mit Stoffmustern, dann las Mama
genüsslich Stoffe aus und bestellte für die
nächsten Monate. Sie war sehr geschickt im Nähen,
und hatte sie sich ein Kleid genäht, ging sie zur
Krönung ihres Werkes in den Hutladen am
Rütschelengässli, um den passenden Hut dazu zu
kaufen. Manchmal begleitete ich sie dabei, aber oft wurde es
mir langweilig bis der passende Hut gefunden war, und ich
schlich mich weg.
|

|
Hatte Mama einmal Zeit für sich, setzte sie
sich an den Flügel und spielte Chopin, Beethoven, Liszt, das war
wunderschön.
|
Ich ging zur Schule. Am schönsten
war das alle Jahre stattfindende Jugendfest, die
Solennität. Wir fieberten alle darauf hin. Die
Mädchen trugen weisse Röcklein, die grösseren
Knaben waren im Kadettencorps. Mama nähte Silvia und
mir die „Solätte" Kleidli aus weissem
Spitzenstoff. Da das Kleid ja nur einmal im Jahr getragen
wurde und wir im nächsten Jahr wieder etwas länger
waren, war Mama erfinderisch, kaufte genügend Stoff und
setzte jedes Jahr wieder ein Volant unten an. Einmal hatten
wir drei Volants, dann wurde es oben zu eng. Am Vorabend
waren Röcklein, schwarze Lackschuhe, neben dem Bett
bereit, die Kränzlein, aus Kornblumen oder
Röschen, im Keller mit Wasser bespritzt. Aus lauter
Vorfreude konnte ich kaum einschlafen. Dann um sechs Uhr am
Morgen läutete die tiefe Glocke, und von unserem
Fenster aus sahen wir an der Kirche die schwarz-weissen
Fähnchen, das schönste Fest meiner Jugend
begann.
|

|
|
Während der Primarschule durfte ich
oft zu Grossmutti nach Bern in die Ferien. Grossmutti wurde
älter und verkaufte das Restaurant in Burgdorf. Onkel
Hans, der Architekt war, baute Häuser in Bern und legte
das Geld für Grossmutti an. Sie hatte ein ungesorgtes
Alter. Ich liebte Grossmutti sehr, sie wohnte zusammen mit
Tante Hedy, der ledigen Schwester meiner Mutter, in einem
Häuschen in der Nähe der Friedenskirche. Ich
schlief neben Grossmutti in einem grossen weichen Bett. Sie
nahm mich mit auf den Märit, und ich half ihr
Körbe mit Gemüse heimschleppen.
|

|
|
Dann waren die unvergesslichen Ferien in
Troinex bei Genf. Dort war die jüngste Schwester von
Mama, Tante Idy, mit Onkel Edmond verheiratet. Onkel Edmond
war, im Ersten Weltkrieg in Burgdorf stationiert,
häufiger Gast im Restaurant Post, dann entführte
er Tante Idy nach Troinex! Die Ferien dort waren so
schön, dass ich sie nie vergesse. Das grosse Haus mit
dem Turm, alle die Tiere, Schweine, Pferde, Hühner, ein
Ententeich; nach dem Heuen durfte ich zuoberst auf dem
Heufuder heimfahren. Onkel Edmond hatte auch Reben bis zum
Salève, an der Grenze zu Frankreich. Er sprach nur
französisch, er war ein liebenswürdiger Onkel.
Einmal setzte er Silvia und mich auf ein Pferd, ritt mit uns
in das Restaurant im Dorf, band das Pferd an einen Baum und
bestellte für uns eine Glace. Ich konnte mir keine
schöneren Ferien denken. Zuoberst im Haus wohnte
Mémé, die Mutter von Onkel Edmond. Silvia und
ich durften abwechslungsweise hinaufgehen, an die Türe
klopfen und sagen: „Madame, le dîner est servi!"
Es wurde immer viel diskutiert, natürlich auf
französisch, mit Edmée und Marcel, den Cousins,
und ich musste mir Mühe geben, mit meinem
Schulfranzösisch etwas zu verstehen. In der grossen
Küche stand ein langer Tisch, dort assen die Knechte
und im Herbst die Frauen, die aus dem nahen Frankreich
kamen, um Trauben zu lesen. Die zierliche Tante Idy war wohl
oft überfordert mit dem ganzen Betrieb.
|

|
Die Kriegsjahre kamen. Viele Lebensmittel waren
rationiert, jedes Plätzchen im Garten musste angepflanzt werden.
Jeden Abend mussten wir die Fenster verdunkeln, niemandem kam es in
den Sinn, noch auf die Strasse zu gehen. Dann gab es Fliegeralarm,
wir mussten in den Keller und hörten dumpf dröhnende Bomber
über uns fliegen. In den letzten Kriegsjahren mussten wir in den
Landdienst, um den Bauernfamilien zu helfen, da die Männer ja
meist im Militärdienst waren. Zuerst war ich im Lerchenboden
nahe Burgdorf. Am Morgen gab es herrlich knusprige Rösti und
Kannen mit Milchkaffee, und ich sah mit grossen Augen wie der Knecht
mit breiten Ellenbogen auf dem Tisch, den Kopf über der
Rösti, ass und den Kaffee schlürfte. Es waren nicht die
Tischmanieren, die man uns zu Hause streng beibrachte! Abends hatte
ich Blasen an den Händen von der ungewohnten Arbeit. Einmal
klemmte Ruedi, der Bauer, ein Paket unter den Gepäckträger
meines (eigentlich Papa`s!) Velo und sagte: „Geisch aber grad
schnäll dermit hei". Es war ein schönes Stück
Schinken.
In Lyssach war ich im Herbst, es wurden Kartoffeln
gegraben, und es regnete viel. Dann sass ich in der heimeligen Stube
und flickte Körbe voller Socken. Einmal kam Fritz der Knecht auf
Urlaub. Beim Fortgehen gab er mir einen Zettel mit seiner Adresse.
Das sah die Bäuerin, sah mich streng an und sagte: „Pass
nume uf, dä muess de scho Alimänt zahle!" Ich wunderte
mich, was er wohl zahlen musste und ich deswegen noch aufpassen
sollte. Daheim erzählte ich es Mama, die lachte herzhaft und
sagte, er wolle doch nur ein Esspäckli in den Dienst; das
erhielt er auch.
Papa erhandelte oder bekam in diesen Jahren von
einem Bauern ein Schweinchen. Es vertrug sich aber schlecht mit den
Schafen, die wir noch in der Hofstatt hinter dem Haus hatten. Es riss
ständig aus, tauchte im Garten auf und frass von Mama‚s
Himbeeren. Einmal spazierte es fröhlich grunzend mitten durch
die Heimiswilstrasse, dabei hätte es allen Grund gehabt, sich
etwas diskreter zu benehmen, Schwarzhandel war strafbar. Davon wusste
das herzige rosa Schweinchen eben nichts. Ich weiss nicht, was mit
ihm geschehen ist, vielleicht gab es Papa zurück.
Im Handarbeitsunterricht strickten wir
feldgrüne Socken für die Soldaten, dann schickten wir sie
mit einem Briefchen und etwas Süssem dazu ins „Feld",
für alle, die an Weihnachten nicht daheim sein
konnten.
Mein letzter Schultag kam. Beschwingt und voller
Zukunftsträume ging ich nach Hause, schmiss die Schulmappe in
eine Ecke. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich lernen wollte. Meine
Eltern hatten vorgesorgt, sie schickten mich nach Lausanne, wo ich
die Handelsschule besuchen konnte. Ich wohnte bei einer Familie
Rossat, deren Tochter Marie-Lise zum Austausch ein Jahr bei uns zur
Schule ging. M. und Mme Rossat waren sehr liebenswürdig zu mir.
An den Sonntagen fuhren wir oft die Reben hinauf, wo hoch oben ihre
Eltern ein Häuschen bewohnten. Die Rebberge, der Genfersee, in
der Ferne die Savoyeralpen haben sich mir tief eingeprägt.
Trotzdem litt ich unter Heimweh. Manchmal durfte ich übers
Wochenende nach Troinex zu den geliebten Tante Idy und Onkel
Edmond.
In der Handelsschule gefiel es mir. Ich lernte auf
einmal wieder mit mehr Eifer und Freude, vor allem Englisch,
Französisch, Maschinenschreiben, Buchhaltung. Mit den neuen
Kameradinnen bummelte ich nach der Schule durch die Stadt, oder wir
gingen zum See hinunter. Ich hatte einen langen Schulweg, den ich
meistens zu Fuss ging, um das Tramgeld zu sparen. So schrieb einmal
Mme Rossat nach Hause „Elle a plus de volonté que de la
force". Oft hatte ich, was man heute kaum mehr glauben kann, Hunger!
Die Luftveränderung, die meisten Lebensmittel waren noch immer
rationiert, und Mme Rossat musste auch einteilen. Sie hatten ein
kleines Gärtchen mit ein wenig Tomaten. Es war nicht wie daheim,
Keller voller Aepfel, Birnen, Eingemachtes, und Mama, die mit viel
Phantasie immer etwas zum Naschen hatte. Ich habe alles trotzdem gut
überstanden. Nach einem Jahr kehrte ich mit einem Certificat de
l`Ecole de Commerce de Lausanne nach Hause.
Daheim, es ist der 8. Mai 1945. Die Glocken
läuten, ich sitze im Garten, der Krieg ist vorbei. Mein ganzes
Leben werde ich nie vergessen, wie wir in all diesen Jahren in
Frieden lebten, sorglos zur Schule gehen konnten, während um
unser kleines Land herum so unvorstellbares Leid geschah, von dem wir
verschont geblieben sind.
Papa war im Vorstand der Lehrlingskommission. Er
brauchte dringend jemand, der ihm die Schreibarbeiten abnahm. Also
wurde ich seine „Sekretärin". Es oblag mir, anlässlich
der Lehrabschlussprüfungen, die aus dem Amtsbezirk Burgdorf
gekommenen Lehrlinge an ihre Verpflegungs- und Schlafstätten
einzuteilen. Das Organisieren machte mir Spass. Wer von weither
kommt, muss übernachten, der andere braucht nur ein Esscoupon.
Den Entwurf musste ich in die Druckerei bringen, danach verschicken.
Wenn ich in die verschiedenen Gaststätten im Städtchen die
Anmeldungen brachte, bekam ich oft einen Fünfliber oder ein Paar
Strümpfe (die damals immerhin 7 Franken kosteten). Daneben
machte ich Papa`s Buchhaltung, die schnell erledigt war.
Abends besuchte ich einen Weissnähkurs und
Kochkurs. Ich nähte Papa ein weisses Hemd, wohlverstanden mit
Kragen nach Mass! Aber kochen mochte ich nicht, das war Mama‚s
Domäne.
|
Ich hatte Zeit genug, las viel und
spielte gerne Klavier. Nach einem Jahr dünkte mich, ich
hätte zu viel Zeit für mich, ich fühlte mich
unausgefüllt. Ich wollte Krankenschwester werden. So
trat ich einstweilen in das Spital in Sumiswald ein. Der
Alltag war streng, und ich sah auf einmal viel Leid. Bald
übertrug man mir die Pflege der Kinder, und noch heute
wundere ich mich, wie man mir die Verantwortung gab,
Spritzen und Medikamente zu verabreichen. Die Schwestern
waren Diakonissinnen, und sie bearbeiteten mich, ihrem Orden
beizutreten. Aber ich wollte einmal heiraten und Kinder
haben.
|
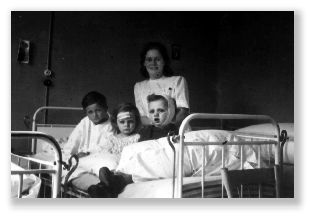
|
Nach einem Jahr voller Eindrücke und
Erfahrungen kehrte ich nach Hause zurück. Da rief Onkel Fritz
aus Bern an, ein Kollege von ihm suche dringend eine Arztgehilfin.
Ich meldete mich und bekam die Stelle. Zuerst musste ich aber noch
Kurse für die notwendigen Laboruntersuchungen im Engeriedspital
besuchen. So fuhr ich jeden Tag mit dem Zug nach Bern. Ich hatte den
Beruf gefunden, der mich erfüllte, ich arbeitete 6 Jahre bei Dr.
Mauerhofer. Alles bisher Erlernte konnte ich gebrauchen. Es gab viele
Berichte zu schreiben, die er mir direkt in die Schreibmaschine
diktierte, oder sie mir mit dem Diktiergerät
übergab.
Dr. Mauerhofer war Internist und Herzspezialist.
Morgens war ich meistens im Engeriedspital und machte EKG, am
Nachmittag war Sprechstunde. Dr. Mauerhofer war Arzt nach alter
Väter Sitte, nahm sich mit all seinen Patienten viel Zeit, und
sie sassen geduldig Stunden im Wartezimmer. Abends um 7 Uhr, wenn ich
zum Zug eilte, war das Sprechzimmer meistens noch fast voll. Musste
ich im letzten Moment noch einen Urin- oder Bluttest machen,
verpasste ich natürlich den Zug, dann kam ich oft um etwa 9 Uhr
nach Hause. Von daheim zum Bahnhof (und zurück) musste ich das
ganze Städtchen durchqueren, meistens im Laufschritt.
Silvia hatte die Handelsschule in Bern absolviert
und arbeitete damals im Schweizerischen Roten Kreuz in Bern. So
sputeten wir gemeinsam morgens zum Bahnhof und abends zurück.
Mittags assen wir zusammen irgendwo etwas, und bei schönem
Wetter sassen wir auf der Bundesterrasse und assen
Früchte.
Papa war wohl ein guter Fach- aber kein geborener
Geschäftsmann, was dazu führte, dass der Mechanische
Fabrikationsbetrieb in Konkurs ging. Sein Vater hatte ihm die
Werkstatt gekauft, ohne lange zu fragen, ob er geeignet dazu war. In
dieser Zeit ging auch die Ehe meiner Eltern auseinander. Papa
hörte mehr auf seine Geschwister als auf sein Herz. Es war eine
traurige Zeit. Trotz seiner Schwächen habe ich Papa geliebt, und
Mama hörte ich nie klagen.
Meine Arbeit befriedigte mich unverändert,
und trotzdem drängte etwas in mir. Ich war noch nie im Ausland,
und ich wollte besser Englisch lernen. So sagte ich schweren Herzens
Dr. Mauerhofer, ich möchte die Stelle aufgeben. Aber er wollte
nichts davon wissen, hatte aber Verständnis für mich und
gab mir ein halbes Jahr Urlaub. So fuhr ich unternehmungslustig nach
Calais, mit dem Schiff über den Aermelkanal, und in London
erwarteten mich Mr. und Mrs. (den Namen weiss ich nicht mehr), bei
denen ich wohnen sollte. Als Kennzeichen trug ich ein blaues Beret!
In Southborne, an der Südküste, erwarteten mich zwei
herzige kleine Kinder, Stephen und Rose Anna. Es wartete aber auch
ein Kübel voller Wäsche auf mich, die mangels einer
Waschmaschine von Hand gewaschen werden musste. Morgens brachte ich
Stephen zur Schule, und am Nachmittag lud ich Rose Anna in den
Kinderwagen, nahm Stephen an die Hand, und wir gingen ans nahe Meer.
Dort konnten sie im Sand spielen, und ich passte auf sie
auf.
Madam rauchte viel, so schickte sie mich in den
Tabakladen gegenüber, um Zigaretten zu kaufen. Mit den
Besitzern, Vater und Sohn Clark, kam ich bald in lebhaftes
Gespräch. Hatte ich einmal frei, luden sie mich zu sich nach
Hause ein. Mrs. Clark war gelähmt und im Rollstuhl, und ich sah
mit Bewunderung, wie sich Mann und Sohn um sie kümmerten. An
einem freien Nachmittag spazierte ich mit Robin zum Meer, endlich
konnte ich schwimmen, ohne auf die Kinder aufzupassen.
Ueberglücklich schwamm ich hinaus, wie herrlich das war! Da sah
ich von weitem Robin am Ufer wild gestikulierend, was hat er wohl?
Ich schwimme zurück, da sagt er, ob ich denn noch nie etwas von
Ebbe und Flut und heimtückischen Strömungen gehört
habe. Da wurde mir erst bewusst, dass das Meer eben kein Schweizer
See ist.
Hatte ich einmal einen freien Tag, unternahm ich
ausgedehnte Busfahrten durch die wunderschöne
Landschaft.
Mr. und Mrs. wollten Verwandte im Norden besuchen,
und zu meiner Unterstützung kam eine Freundin der Familie ins
Haus. Der abgemachte Termin bei Dr. Mauerhofer rückte immer
näher, und von beiden noch keine Spur. Ich habe sie nicht mehr
gesehen, so wenig wie den Lohn, den sie mir noch schuldeten. Ich
liess die Kinder in der Obhut der Freundin zurück. Robin brachte
mich mit dem Auto nach London, zeigte mir noch die Stadt, dann kam
nur noch das Flugzeug in Frage. Das Geld dazu musste er mir borgen
(ich schickte es mit meinem ersten Lohn daheim zurück!) So flog
ich zum ersten Mal in meinem Leben. In Zürich holte mich Silvia
ab, und sie musste mir auch gleich das Geld für den Zug nach
Hause leihen.
Inzwischen hatte Mama ein neues Zuhause gefunden.
Eine Schulfreundin von ihr besass ein Haus in der Nähe beim
Bahnhof, und die Parterrewohnung wurde frei. Es war auch ein kleiner
Garten vorhanden, was unser Hund Boby schätzte, und Silvia und
ich hatten nun einen kurzen Weg zum Bahnhof. Ruedi hatte sein Studium
am Technikum beendet und trat seine erste Stelle in Liestal
an.
|
Tante Trudi, wie wir sie nannten, war
ledig, und wir hatten sie sehr gerne. An einem freien
Nachmittag wollte ich einkaufen gehen, traf Tante Trudi und
fragte sie, ob sie auch etwas brauche. Ja, sagte sie, bringe
mir Mäusegift von der Drogerie. Als ich bei ihr
anklopfte, sass auf der Ofenbank ein junger Mann in einem
schwarzen Sportpullover. Tante Trudi stellte ihn mir als
Herrn Mützenberg vor, Student am Technikum, und er
wohne bei ihr in einem Zimmer. Er gab mir die Hand, dann
musterte er mich mit seinen warmen braunen Augen von oben
bis unten. Von da an hielt ich immer Ausschau, ob ich ihn
wohl sehen würde. Eines Tages läutete es an der
Tür, er stand draussen und lud mich zu einem Tanzabend
bei seiner Studentenverbindung ein. Um es kurz zu sagen, ich
war verliebt! Wir gingen spazieren, über die
Flühe, der Emme entlang. Ich war vorher schon oft
verliebt, aber es war stets wie ein Strohfeuer, schnell
entbrannt und schnell erloschen. Diesmal, sagte mir mein
Gefühl, ist es anders.
|

|
Eines Abends, ich komme heim von Bern, steht ein
Motorrad in der Einfahrt, mit Kennzeichen GB. Und wer sitzt in der
Stube, Robin. Mama, gastfreundlich wie immer, gab ihm ein Zimmer im
Estrich. Er habe, sagte sie, im Städtchen herum meine Photo
gezeigt und nach einer Miss Ludwig gefragt. Ich befand mich in einer
äusserst heiklen Situation. Einerseits konnte ich ihn nicht
einfach links liegen lassen, und anderseits musste ich unbedingt
vermeiden, dass mich Hämi (er hiess Abraham mit Vornamen) mit
dem Engländer zusammen sah. Ich zerbrach mir den Kopf, dann kam
mir Silvia in den Sinn, sie würde mir schon aus der Patsche
helfen. Sie sollte mit ihm auf dem Töff über ein paar
Pässe fahren und ihm etwas von der Schweiz zeigen. Sie tat es,
und ich bin ihr noch heute dankbar. Sie sagte mir zwar später,
wie sie Aengste ausgestanden habe hinten auf dem Töff. Robin
kehrte unverrichteter Dinge nach England zurück, und mich plagte
nachher lange mein Gewissen, dass ich diesen lieben Menschen
abgewiesen hatte. Aber ich liebte eben einen anderen.
Onkel Hans baute Reihenhäuser an der
Muristrasse in Bern. Das Erbe von Grossmutti investierte er in das
Mehrfamilienhaus an der Muristrasse 88. Grossmutti und Tante Hedy
lebten dort in einer bequemen Wohnung. Grossmutti konnte daheim in
ihrem grossen Bett sterben, bis zuletzt umsorgt von Tante Hedy.
Mama mochte nicht länger in Burgdorf bleiben,
so bezogen wir, Mama, Silvia und ich, eine Wohnung an der Muristrasse
88. Die langen Zugfahrten für Silvia und mich waren
vorbei.
Hämi hatte inzwischen sein Studium
abgeschlossen, fand eine erste Stelle in Ems, Graubünden, und
nach einem Jahr wechselte er zur Chemiefabrik Geigy in
Basel.
|
Wir wollten heiraten. Es war auch Zeit,
dass ich mich in Spiez zeigte, wo seine Eltern wohnten und
wo er aufgewachsen war. Ich kam in ein schönes grosses
Haus, inmitten von Reben gelegen, mit wunderbarem Blick auf
den Niesen und die Schneeberge. Sein Vater war Architekt und
die Mutter Kunstmalerin. Sie verstand es, die Schönheit
der Blumen ihres Gartens auf die Leinwand zu bannen. Aber
ich wurde nicht gerade mit Pauken und Trompeten empfangen!
Der Sohn hatte eben fertig studiert, und nun wollte er schon
heiraten. Aber mit der Zeit schickten sich seine Eltern ins
Unvermeidbare, sie bemerkten wohl auch, dass ihr Sohn nicht
eben unglücklich war.
|

|
In der Praxis Dr. Mauerhofer führte ich meine
Nachfolgerin in alle Arbeiten ein, dann nahm ich etwas wehmütig
Abschied von meinem langjährigen gütigen, oft gestressten
Chef. Aber ich freute mich auf meinen neuen
Lebensabschnitt.
|
24. April 1954. Nach langen kalten Tagen
mit teils Schneegestöber bricht ein strahlender Tag an,
unser Hochzeitstag. In Spiez ein tiefblauer Himmel, in der
Ferne die frisch verschneiten Berge. Wir werden im
historischen Schlosskirchlein getraut, von Pfarrer Werner
Fankhauser, der ein Onkel von Hämi ist.
|

|
(Heute, wie ich das schreibe, ist der 24. April
1997. Es ist ebenfalls ein strahlender, sonniger Tag. Wir fahren um
den Hallwilersee, und wir sind dankbar, dass wir nach 43 Jahren noch
immer zusammen sein dürfen).
Nach einem fröhlichen Fest im Hotel des
Alpes, mit Verwandten, vielen Onkeln und Tanten, ging es auf
Hochzeitsreise mit unserem Simca, den Hämi seinem Vater
abgekauft hatte. Wir waren demnach stolze Besitzer eines Autos! Bald
einmal bemerkte Hämi ein ungewöhnliches Geräusch am
Auto, auch fiel uns auf, dass alle, die uns überholten,
fröhlich zu uns winkten. Beim nächsten Halteplatz sahen wir
hinten am Auto an einer langen Schnur ein alter Schuh und eine
Büchse, dazu die Aufschrift „just married!"
Unsere Reise ging ins Tessin. In Ronco, ob Ascona,
fanden wir eine Unterkunft. Aber bald einmal bemerkte mein frisch
Vermählter, dass das Geld knapp wurde. Er realisierte, dass er
nun für zwei aufkommen musste! So fuhren wir eben zurück
nach Spiez, läuteten an der Türe, und die Mutter konnte
sich kaum fassen vor Freude. Sie hatte wohl gedacht, dass wir uns
für immer verabschiedet hatten.
Natürlich fuhren wir noch nach Bern zu Mama
und Silvia. Auf dem Weg nach Basel fing ich zu weinen an, es wurde
mir auf einmal schmerzlich bewusst, dass nun unsere jahrelange
vertraute Dreisamkeit für immer vorbei war. Hämi ertrug es
mit Fassung, nur einmal brummte er, dass er ja auch noch da
sei!
In Basel richteten wir unsere 2-Zimmerwohnung
gemütlich ein. Nun war ich Hausfrau, und das Kochen begann mir
Freude zu machen. Bei meiner ersten Einladung, es gab Reis und
Fleischspiessli, kochte ich so viel Reis, dass es dann noch tagelang
Resten zu essen gab. (Hämi liebt heute noch immer
Reis).
Der kleine Haushalt war schnell erledigt, und die
Hektik der letzten Jahre fehlte mir. Ich sah in der Zeitung ein
Inserat, dass ein Chirurg für den Nachmittag eine Arztgehilfin
brauchte. Ich meldete mich sofort und bekam die Stelle. Meine Tage
waren nun ausgefüllt.
Ich wollte Auto fahren lernen. Hämi gab mir
die ersten Fahrstunden, dabei fing es zu kriseln an. Er ist
Motorfahreroffizier, sie sitzt zum ersten Mal hinter dem Steuer,
anstatt auf dem bequemen Beifahrersitz. Dabei hat sie keine Ahnung
von dem Innenleben eines Motors, dazu kommen fünf Gänge,
und man muss beim Zurückschalten noch jedesmal Zwischengas
geben. Aber ich schaffte es. Stolz legte ich meinen Führerschein
auf sein Pult, und es dauerte eine Weile, bis er merkte, dass es
meiner war. Von da an fuhr ich mit dem Auto zu Dr. Geymüller,
und Hämi mit dem Tram ins Büro.
Wir waren glücklich. Aber es ging Hämi
wie mir seinerzeit bei Dr. Mauerhofer - er wollte nicht sein Leben am
gleichen Arbeitsplatz verbringen, ins Ausland gehen und dort
Erfahrungen sammeln. Amerika war sein Ziel, und ich war begeistert.
Er schickte verschiedene Bewerbungsschreiben an
Firmen in die USA und hatte zwei Angebote. Drei Monate vor Ablauf der
Kündigungsfrist offerierte ihm der Direktor für die
Produktion Ausland der Geigy eine Stelle im Werk McIntosh, Alabama.
Um unabhängig zu bleiben, wollten wir die Reise selbst
finanzieren. Also fingen wir zu planen, und vor allem zu sparen an.
Unseren damals noch kleinen Hausrat sandten wir in zwei
Ueberseekisten direkt nach McIntosh.
Im April 1956, nach einem allseits gefassten
Abschied (sie kommen ja bald wieder!) ging die Reise über Paris,
dann durch die wunderschön blühende Landschaft nach Le
Havre. Dort schifften wir uns in der Liberté ein. Auf Deck
sahen wir, wie der grosse Dampfer langsam aus dem Hafen fuhr. Niemand
winkte uns nach, und es war uns auf einmal etwas traurig zu Mute. Wir
bezogen eine kleine Kabine mit einem Bullauge knapp über der
Wasserlinie. Dafür entschädigte uns das feine
französische Essen, das wir nach den letzten Strapazen sehr
genossen. Die Tage verbrachten wir zum grossen Teil auf Deck mit
Tischtennisspielen, wovon ich nie genug bekam. Einmal schlug ich den
Kapitän (vielleicht war es nur der 1. Offizier!)
Nach sieben Tagen wurden auf einmal die Motoren
langsamer, was wir in unserer Kabine gut zu hören bekamen. Wir
eilten auf Deck, da sahen wir von weitem die Wolkenkratzer von
Manhattan und die Freiheitsstatue.
Die Einwanderungskontrolle durch die
Emigrationsbehörden zog sich in die Länge, weil wir in zwei
Koffern Objekte mit Leuchtziffern mitführten, ein Wecker und ein
Kompass. Diese brachten die Geiger Zähler wüst zum Pfeifen!
Wir mussten in einem Gitterkäfig warten, bis die Koffern
gründlich durchwühlt waren, danach erteilte uns der
Kontrolleur den Freipass.
Endlich fuhren wir per Taxi ins Geigy Büro,
wo wir freundlich empfangen wurden. Wir übernahmen das Auto von
Charly Brogli, einem Arbeitskollgen aus Basel, der in die Schweiz
zurückkehrte, und zum Austausch bekam er unseren Simca. Wir
waren nun Besitzer eines grossen Hudson Ambassador, mit einem noch
grösseren Benzin- und Oelverbrauch, was Hämi bei jeder
Tankstelle mit Schrecken feststellte. In dem geräumigen Wagen
ging die Reise Richtung Süden, und wir staunten über die
Weite der Landschaft. Der erste Halt war Washington, dort trafen wir
einen Chemiker der Firma Geigy, der uns zu einem feudalen Nachtessen
einlud. Ueber die Smoky Mountains kamen wir immer weiter nach
Süden, und es wurde immer heisser. Wir packten unsere
Sommerkleider aus dem Koffer. Da erblickten wir auf einmal eine Tafel
am Strassenrand „Welcome to Alabama, you all come". Bald waren
wir in Jackson, wo wir wohnen wollten. Nachdem wir einige Zeit bei
einem Schweizer Ehepaar untergebracht waren, fanden wir ein kleines
Haus zum Mieten. Als ich die Küche betrat, glaubte ich nicht
recht zu sehen, so einen grossen Kühlschrank hatte ich noch nie
gesehen.
Wir lebten uns schnell ins neue Leben ein.
Hämi fuhr mit zwei Schweizern und drei Amerikanern ins 40 km
gelegene McIntosh (es wurde abwechslungsweise gefahren), und ich
begann das Häuschen gemütlich einzurichten.
Auf der ganzen Reise war mir immer übel
gewesen, nun wurde es zur Gewissheit, wir sollten auf Weihnachten ein
Kindlein bekommen. Wie freute ich mich! Aber es sollte nicht sein.
Ich musste ins kleine Spital in Jackson, wo ich das sehnlich
Erwartete verlor. Im Zimmer neben mir lag eine Frau mit dem gleichen
Schicksal, die ganze Familie war um sie versammelt um sie zu
trösten. Da zog ich die Decke über mich und weinte
bitterlich.
Wieder daheim begann ich mit Eifer zu nähen,
zum Glück hatte ich meine Bernina mitgenommen. Ich kam mir vor
wie einst Mama! Ausser einmal in der Woche hatte ich das Auto zur
Verfügung, so fuhr ich manchmal ins etwa 100 km gelegene Mobile,
dort kaufte ich Stoffe und Muster. Ich nähte mir Kleider,
Hämi bekam einen Morgenrock und Bademantel.
Wir waren auch oft eingeladen, das Vorurteil, dass
die Amerikaner meist Büchsen öffnen, da wurden wir bald
eines Besseren belehrt. Da gab es wunderbare Aufläufe, Desserts,
und alles selber gemacht. Auch hatte ich liebe Nachbarinnen, die mich
oft spontan zu einem Kaffee einluden.
Natürlich wollten wir uns auch zum Essen
revanchieren, und auf unsere Frage, was sie für eine
Spezialität aus der Schweiz wünschten, kam jedesmal: cheese
Fondue! Also mussten wir uns etwas einfallen lassen. In Mobile fanden
wir im Hafenquartier einen Griechen, der in seinem Laden viel
Importiertes führte, so auch Schweizerkäse. Das hatten wir
nun, und das knusprige Pariserbrot? Es gab nur weisses Toastbrot. So
fing ich an, Brot zu backen, und es duftete dann jeweils wunderbar
durchs ganze Häuschen.
Das Clarke county, in welchem wir wohnten, war
„dry county", d.h. es gab keine Verkaufsstelle für
alkoholische Getränke. Citronelle oder Mobile waren die
nächsten Orte, um den Wein zu kaufen. Das Fondue Caquelon hatten
wir im Hausrat mitgenommen, so waren wir nun ausgerüstet.
Ich schrieb viel und ausführlich nach Hause,
über unser neues Leben und den Alltag. Dabei erwähnte ich
wohl auch einmal das komplizierte Zusammenbringen der Fondue Zutaten.
Da kommt doch eines Tages ein grosses Paket aus der Schweiz (die Post
holte ich im Post office ab). Und was packe ich aus? Schön in
einer noch schöneren bemalten Leinwand eingewickelt eine Flasche
Spiezerkirsch, für unsere amerikanischen Gäste zum
Fondue!
Die erste Weihnacht in der Fremde nahte.
Hämis Mutter schickte uns Kerzenhalter und Kerzen. In Amerika
brennen die elektrischen Kerzen am Baum den ganzen Dezember jeden
Abend vor dem Fenster. Wir blieben unserer Tradition treu und
zündeten die Kerzen erst am 24. Dezember an, was ein
äusserst riskantes Unterfangen war, wie wir bald feststellten!
Der Baum war dürr, der Wasserkessel bereit, und unsere kleine
Katze, die zu uns kam, liebäugelte mit dem Baum und war
sprungbereit! Ich hatte den Tisch für uns zwei schön
gedeckt, dann kamen alle Nachbarn um unseren Baum zu
bestaunen!
|
Inzwischen hatte ich mich mehr oder
weniger an das heisse Klima gewöhnt und ich war wieder
in Erwartung. Am 4. Oktober 1958, an einem Samstag morgens
um genau 10 Uhr kam Martin zur Welt, ein hübsches
gesundes Büblein. Meine Befürchtung, er
könnte im Spital verwechselt werden, (ich hatte eben
eine solche wahre Geschichte gelesen), erwies sich als
unbegründet. Um ihn herum schliefen und krähten
alles kleine Negerlein! Dazu sagten meine Besucher jedesmal:
oh, he looks like his Daddy! Hämi verteilte im
Geschäft, wie es Brauch war, stolz Cigarren mit der
Aufschrift: it's a boy!
|

|
Wir zügelten in ein grösseres Haus,
hinten im Garten spendeten grosse alte Pecan Bäume Schatten.
Auch hatten wir wieder liebe Nachbarn. Martin schlief in einem
geräumigen Zimmer, Fliegengitter waren überall. Die Idylle
war nicht von Dauer, der Besitzer des Hauses wollte es verkaufen, und
wir erhielten natürlich das erste Kaufangebot. Aber um es zu
kaufen, war das Haus zu alt, um Geld hineinzustecken. Nebst dem war
es voller cockroaches, grausige schwarze Biester, die aus allen
Ritzen hervorkamen. Ein Bekannter riet uns, baut doch euer eigenes
Haus. Kurz entschlossen bestellten wir unser neues Haus bei einem
Generalunternehmer. Nach etwa sechs Monaten konnten wir schon
einziehen, in ein Haus, wie es in den Südstaaten typisch
ist.
|
Bald waren wir eingerichtet in dem
kellerlosen einstöckigen Haus mit vier Zimmern. Um den
Garten einigermassen zu gestalten, brauchte Hämi Hilfe.
So ging er jeweils am Samstag „downtown", dort sassen
die Neger untätig herum, und für einen guten
Stundenlohn hatte er bald eine Hilfe.
|

|
Irgendeinmal lasen wir ein Inserat, junge Dackel
zu verkaufen. Hämi bekam als Bub von seinem Götti einen
Dackel geschenkt, der nur ein kurzes Leben hatte, er sprach viel von
seinem eigenen Tier. Wir fuhren in die Nähe von Mobile, nur um
zu schauen. Natürlich kehrten wir mit einem braunen Dackel heim,
und Bella teilte unser Leben während den nächsten 15
Jahren. Er hütete Martin wie sein eigenes Kind, liess niemand
Fremdes in seine Nähe.
Im Frühling 1959 erhielten wir einen teils
Geschäfts- und privaten Urlaub in die Schweiz, diesmal von der
Firma bezahlt! So flogen wir mit Martin erstmals in die Schweiz. In
der Kirche in Spiez fand die Taufe statt, im Beisein von allen
unseren Lieben. Der Abschied fiel uns, vor allem mir nicht sehr
leicht, aber wir freuten uns, wieder bei uns daheim zu
sein.
|
Nach zwei Jahren kam wieder ein
glücklicher Tag, d.h. es war Nacht. Am 6. November 1960
Sonntag nachts um 2 Uhr kam Stefan zur Welt, wieder ein
gesunder kräftiger Bub. Ich hatte nun meine Kinder, die
ich mir immer gewünscht hatte.
|

|
|
Hinter dem Haus entstand ein Sitz- und
Spielplatz, mit einem luxuriösen Sandkasten samt Dach
und elektrischer Lampe, weil es in diesem Breitengrad im
Sommer früh und sehr schnell dunkel wird.
Natürlich fehlte das Plastikbad den langen heissen
Sommer hindurch nicht. Ein Grill weiter unten im
Wäldchen wurde ebenfalls gebaut, alles natürlich
von Hämi.
|

|
|
An den Sonntagen fuhren wir durch die
nahe Landschaft, durch weite Wälder, die mit spanish
moos behangenen alten Eichenbäume, zum Alabama- und
Tombigbeeriver, die rote Erde, alles war uns bald
vertraut.
|
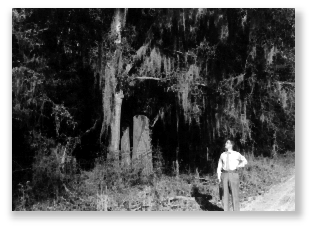
|
|
Die Ferien verbrachten wir immer im
gleichen Cottage in Gulf Shores, am Golf von Mexiko. Das
Häuschen lag direkt am wunderschönen Sandstrand,
einige Meter vom Meer entfernt. Die Buben spielten im Sand
und plantschten in einem angeschwemmten
Meerwassertümpel. Bella scharrte vergnügt ein Loch
und spritzte mir den Sand auf meine eingeölten Arme und
Beine. Es waren herrliche Ferien für alle.
|

|
|
Ich kann das Kapitel Jackson nicht
abschliessen, ohne Chippi zu erwähnen. Chippi, die
rundliche, gütige Negerin, die uns die Kinder
hütete, wenn wir weg waren, und mir bei Bedarf im
Haushalt half. Sie liebte die Buben, und es war
gegenseitig.
|

|
|
Wir hatten auch einige Besucher aus der
Schweiz, und wer kam zuletzt? Mama! Sie, die nie zuvor im
Ausland war, wagte den weiten Sprung zu uns. Ich sah mit
Bewunderung, wie sie sich unseren Lebensgewohnheiten und dem
heissen Klima anpasste, ohne jemals zu klagen. Sie kam sogar
mit uns auf unser Motorboot, das wir uns angeschafft hatten,
liess sich eine Schwimmweste anziehen und fuhr mit uns auf
dem Tombigbeeriver! Während sie auf die Buben
aufpasste, übten Hämi und ich uns im
Wasserskifahren.
|

|
Martin ging in den Kindergarten, zusammen mit Mimi
Mudd, dem Nachbarsmädchen. Bald sollte er zur Schule gehen, und
wir überlegten uns, bleiben wir oder kehren wir in die Schweiz
zurück. Wir entschieden uns für das zweite. Bald prangte
ein Schild vor unserem Haus: For sale! Hämi malte noch
gründlich die Fassade des Hauses, um es etwas attraktiver zu
präsentieren. Es wurde von einem Maler gekauft!
Am Abreisetag kam ein Lastwagen, flinke
Männer verpackten Geschirr und Gläser fachmännisch in
Kisten, die Möbel wurden weggetragen, bald war alles leer. Beim
Wegfahren aus Jackson, das uns fast acht Jahre Heimat war, sah ich
noch Chippi, ich winkte ihr lange nach.
So ging die Reise los, die Buben trugen neue
braune Wollmäntelchen mit passenden Mützen für den
kalten Winter daheim. Bella hockte in einer Kiste, die Hämi
gezimmert hatte, in der sie den Flug verbringen musste. Am 23.
Dezember 1963 landeten wir in Kloten. Ich wohnte erst einmal mit
Kindern und Hund in Spiez, wo genug Platz für uns war. Hämi
begann seine Arbeit in Basel und war auf der Suche nach einer
Wohnung, das war nicht einfach! Alle waren wir uns «freien
Auslauf» gewohnt und konnten uns ein Leben in einer Stadtwohnung
nicht vorstellen. Aber wir hatten Glück. Hämi fand ein
Reihenhaus zum mieten in Riehen, mit einem Gärtchen und in
Waldnähe. Die Buben gewöhnten sich auch schnell daran, dass
sie mit den Kindern auf der Strasse nicht mehr englisch sprechen
konnten, obschon das Baseldeutsch auch so etwas wie eine Fremdsprache
für sie war.
Hämi kam abends stets pünktlich nach
Hause, was kein gutes Zeichen war. Eines Tages sagte er zu mir:
«Wenn du wieder nach Amerika gehen möchtest, ich komme
sofort.» Ich hatte schon lange gemerkt, dass ihm die Arbeit in
Basel nicht mehr das bedeutete wie in Amerika, und das steife Getue
war auch nicht nach seinem Geschmack. Es war eben nicht mehr Mc
Intosh, Alabama. Doch diesmal war ich nicht mehr begeistert! Die
Buben gingen zur Schule, die Eltern wurden älter, Ruedi und
Silvia waren verheiratet und ich verstand mich gut mit Annali und
Alberto und hatte beide gern. Und nun wieder alles
verlassen?
Bald wurde Hämi zum technischen Direktor
Geigy vorgeladen. Er stellte ihn vor die Wahl, eine neue Stelle in
Amerika zu übernehmen, oder den Posten des Werkingenieurs
für das zum Bau beschlossene neue Werk Kaisten zu
übernehmen. Er meinte, das sei das Angebot seines Lebens und
entschloss sich für Kaisten. Im Lauf der Jahre wurde er
Vizedirektor, was seine Eltern noch erlebten und mit Stolz
erfüllte.
Wir fanden in Frick am Sonnenhang Bauland und
planten unser Haus. Nach fünf Jahren in Riehen zogen wir ein,
und Bella war noch immer mit dabei.
Mama, die nicht mehr allein in Bern wohnen und
haushalten konnte, verbrachte ihre letzten fünf Jahre bei uns.
Unsere Söhne studierten und zogen nacheinander aus.
Für Hämi und mich wurde Frick das
bleibende Daheim.

als PDF-Datei downloaden [16.8 MB]
zurück